
Berlin und Brandenburg
Ein gemeinsames Bundesland sind Berlin und Brandenburg bislang nicht geworden.
Doch die regionale Entwicklung hat auch vor der Hauptstadtregion nicht Halt
gemacht. Brandenburger arbeiten in Berlin, Berliner leben in Brandenburg,
an den Stadträndern verbinden Regionalparks Stadt und Umland. Doch
nicht nur biografisch wachsen Berlin und Brandenburg zusammen. Ein wichtiger
Faktor zu Herausbildung einer regionalen Identität sind die Kulturlandschaften
zwischen Prignitz und Lausitz, zwischen Uckermark und Fläming. Sie
sind Thema nicht nur der jährlichen Kampagnen von Kulturland Brandenburg,
sondern auch zahlreicher Raumpioniere, die sowohl auf dem Land als auch
in der Stadt leben und arbeiten. Obwohl oder gerade weil Berlin und Brandenburg
zum "Armenhaus" Deutschlands gehören, hat sich vielerorts
ein gesellschaftliches und kulturelles Laboratorium entwickelt, das auch
vor scheinbaren Tabus nicht zurückschreckt. Diesem Denken fühlt
sich auch der Schwerpunkt "Berlin und Brandenburg" auf uwe-rada.de
verpflichtet.
"Zu Fuß kommt man am besten heran"
Bertram Weisshaar erkundet Landschaften, indem er sie begeht. Ein Gang durch den ehemaligen Braunkohletagbau Profen südlich von Leipzig
lesen Sie weiter ...
Die Grenzen der Freiheit
In Brandenburg ist der freie Zugang zu Ufern in der Verfassung verankert. Doch die Realität sieht anders aus. Ein Besuch an gesperrten Ufern der Spree (taz Stadtland vom 17. März 2025)
lesen Sie weiter ...
Fluss ohne Grenzen
Gleich an zwei Stellen verlief die innerdeutsche Grenze durch die Spree. Nach dem 9. November 1989 wurde sie zu einer der großen Gewinnerinnen des Mauerfalls. Doch der Gewinn ist ungleich verteilt (taz vom 8. November 2024)
lesen Sie weiter ...
Der Lunik Moment
Kein Spekulationsobjekt mehr, sondern einmalige Chance: Seit einem Jahr diskutiert die Stahlstadt darüber, was aus dem Hotel Lunik werden soll (taz vom 11. August 2024)
lesen Sie weiter ...
Auf dem Trockenen
Die Millionenstadt Berlin fördert ihr Trinkwasser aus der Spree. Was aber passiert, wenn diese nach dem Kohleausstieg kaum noch Wasser führt? Eine Studie schlägt unter anderem eine Überleitung aus der Elbe vor. Steckt dahinter der Bergbaubetreiber Leag? (taz stadtland vom 29. juni 2024)
lesen Sie weiter ...
Bäumen beim Wachsen zusehen
In Eberswalde haben Absolventen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung einen Verein gegründet, der Tiny Forests pflanzt. Bringt das was? (taz-Stadtland 9. März 2024)
lesen Sie weiter ...
Unruhe im Unteren Odertal
Mit Zäunen soll die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindert werden. Im Nationalpark Unteres Odertal sind sie Todesfalle für Wildtiere (taz-stadtland 2. März 2024)
lesen Sie weiter ...
Kulturpolitik nach Gutsherrenart
Der Hamburger Intendant Daniel Kühnel soll mehr Kultur in die Lausitz bringen. Doch die Menschen werfen ihm vor, selbstherrlich zu sein (taz vom 1. November 2023)
lesen Sie weiter ...
Bäume, die auf Kohle stehen
Schon vor mehr als hundert Jahren sind in der Lausitz auf ehemaligen Tagebauflächen Kippenwälder entstanden. Nach der Aufforstung mit Kiefern werden heute auch Laubbäume gepflanzt (taz Stadtland vom 12. September 2023)
lesen Sie weiter ...
Berlins Großgrundbesitz
Vor 150 Jahren wurden die Berliner Stadtgüter gegründet. 17.000 Hektar Land vor den Toren besitzt die Hauptstadt bis heute. Was macht man bloß damit? (taz Stadtland vom 13. August 2023)
lesen Sie weiter ...
"Das Land ist viel weiter als wir denken"
Lisa Maschke forscht zu den Potenzialen ländlicher Räume für die sozial-ökologische Transformation. Ein Gespräch über kritische Landforschung, die AfD und die weißen Flecken der Geografie (taz Stadtland vom 14. Oktober 2023)
lesen Sie weiter ...
"In Oderberg gibt es viel Reibung"
Ab Samstag wird das leere Rathaus in Oderberg künstlerisch bespielt. Ein Gespräch über Gentrifizierung auf dem Land und das Interesse des Investors (taz vom 8. Juni 2023)
lesen Sie weiter ...
Vor dem Feuer
Was tun, wenn‘s brennt? Die Stiftung Stift Neuzelle will nicht warten, bis das Feuer wütet. Waldbrandschutz und Waldumbau sollen Hand in Hand gehen (taz vom 2. Juni 2023)
lesen Sie weiter ...
Das zerrissene Gewebe der Stadt
Aus dem "preußischen Manchester" wurde eine sterbende Stadt. Das erneuerte Textilmuseum in Forst soll ein Ort zum Bleiben sein (taz-Stadtland vom 28. März 2023)
lesen Sie weiter ...
"Wir können Denkräume anbieten"
Ulrike Kremeier leitet in Cottbus das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst. Ein Gespräch über den Strukturwandel in der Lausitz (Wochentaz, 10. Dezember 2022)
lesen Sie weiter ...
Die kleine Schwester
Potsdam, die kleine Schwester Berlins, bestach einst durch ihren maroden Charme und die Lesbarkeit brandenburgisch-preußischer Geschichte. Dann wurde sie hochnäsig. Kein Ort zum Leben, findet unser Autor, obwohl er selbst mal damit geliebäugelt hat (taz-Stadtland, 19. November 2022)
lesen Sie weiter ...
"Es könnte ungemütlich werden"
Einst war Ernst Paul Dörfler Mitbegründer der Grünen in der DDR. Nun fordert er die Deutschen auf, die Städte zu verlassen und aufs Land zu ziehen (taz-Stadtland, 4. Oktober 2022)
lesen Sie weiter ...
Der gerupfte Adler
Brandenburgs historische Identität ist von Brüchen geprägt. Die neue Dauerausstellung in Potsdam wartet aber auch mit aufregenden Objekten auf (taz vom 2. Mai 2022)
lesen Sie weiter ...
Der Herr der Teiche
Die Genossenschaft Schlaubefisch ist der zweitgrößte Teichbetrieb im Land Brandenburg. Doch es wird sie bald nicht mehr geben (Aus dem Kursbuch Oder-Spree 2022)
lesen Sie weiter ...
Die Oase in der Wüste
Im brandenburgischen Großräschen ist der Strukturwandel nach der Braunkohle vollbracht. Wesentlichen Anteil daran hatte Rolf Kuhn. Ein Besuch vor Ort (taz-stadtland vom 26. Dezember 2021)
lesen Sie weiter ...
Die Wüste lebt
Die Lausitz verkörpert alles, was wir eigentlich nicht mögen. Arbeit von gestern, Kohle, geschundene Landschaft. Zeit für eine Liebeserklärung (b-taz vom 31. Juli 2021)
lesen Sie weiter ...
Achse des Bauens
Von Berlin über Lübben nach Cottbus: Mit der Innovationsachse Berlin Lausitz will auch Berlin vom Strukturwandel profitieren (b-taz vom 31. Juli 2021)
lesen Sie weiter ...
Zwischen Grunow und Alexanderplatz
Wo ist das eigentlich, das Ankommen? Und wie ist es zu beschreiben? Ein Auszug aus Uwe Radas neuem Buch "Siehdichum. Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft" (taz vom 7. Juli 2021)
lesen Sie weiter ...
Das Gras über dem Grauen
Jamlitz ist der Ort mit den meisten Opfern der Shoa in Brandenburg. Bis die Erinnerung dorthin zurückkehrte, dauerte es lange (taz Nahaufnahme vom 27. Januar 2021)
lesen Sie weiter ...
"Eine Krise der Stadt"
Sabine Kroner lebt in Neukölln und in der Uckermark. Dass immer mehr Berliner aufs Land wollen, sieht sie auch als Chance für den ländlichen Raum (b-taz vom 26. April 2020)
lesen Sie weiter ...
Mark und Metropole brauchen sich
Hilfe, die Berliner kommen! Die Abschottung des Lankreises Ostprignitz-Ruppin in der Coronakrise hat das Zeug, alte Ressentiments zu befeuern (taz vom 28. März 2020)
lesen Sie weiter ...
Ausmisten!
Preußen raus, Alltag rein. Weil die alten Ausstellungen verstaubt waren, gehen das Museum Oder-Spree auf der Burg Beeskow und das Oderbruchmuseum in Altranft neue, offene Wege (b-taz vom 28. Februar 2020)
lesen Sie weiter ...
Stille Dörfer, laute Dörfer
Können Dörfer gentrifiziert werden? Dieser Frage ging eine Debatte in Berlin-Kreuzberg nach. Sie zeigte, dass die Lust aufs Land erst begonnen hat (taz vom 27. Februar 2019)
lesen Sie weiter ...
"Die ganze Stadt war bewaffnet"
Die Kulturprojekte organisieren den "Themenwinter" Novemberrevolution. SPD und Linke waren dabei nicht immer entspannt, sagt Moritz van Dülmen (taz vom 20. Oktober 2018)
lesen Sie weiter ...
Die vergessenen Revolutionäre
Die Matrosen der Volksmarinedivision werden in der Geschichtsschreibung als Spartakisten geschmäht oder ignoriert. Eine Spurensuche in Berlin (b-taz vom 6. Oktober 2018)
lesen Sie weiter ...
Jüdisches Leben an der Oder
Die Ausstellung "Im Fluss der Zeit" erinnert an das Schicksal deutscher und polnischer Juden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie vor 1990 in Vergessenheit geraten waren (taz vom 18. September)
lesen Sie weiter ...
Die vergessene Abschiebung
Vor 80 Jahren schoben die Nazis polnische Juden an die deutsch-polnische Grenze ab. An sechs Familien in Berlin erinnert nun eine Ausstellung (taz vom 18. Juli 2018)
lesen Sie weiter ...
Heimat für alle
"Sharing Heritage" lautet das Motto des Europäischen Kulturerbejahres. Hört sich gut an. Aber wollen wir unser Erbe wirklich mit allen teilen?
(taz-Meinung vom b-taz vom 17. April 2018)
lesen Sie weiter ...
"Ohne sie wäre Berlin Provinz"
Zum 600. Jahrestag der Hohenzollernherrschaft in der Mark Brandenburg blickt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten mit der Ausstellung "Frauensache" auf die Frauen am Hof. Ein Gespräch mit Kuratorin Nadja Bender (b-taz vom 22. August 2015)
lesen Sie weiter ...
"Wir haben den Hunger nach Land unterschätzt"
Kenneth Anders ist schon in den neunziger Jahren von Berlin ins Oderbruch gezogen. Seitdem beschäftigt sich der Kulturwissenschaftler mit der Zukunft der peripheren Räume in Brandneburg. Und warnt davor, dass sie ähnlich entmischt und aufgewertet werden wie in der Stadt (b-taz vom 8. März 2014)
lesen Sie weiter ...
Meine Mütze, mein Kiez, meine Geschichte
Die meisten Berliner Museen haben das Wort Heimat schon aus ihrem Namen gestrichen. Wo sich die Bevölkerung wenig verändert, wird die Lokalgeschichte aber immer noch traditionell erzählt. Je mehr Zuwanderung es gibt, desto größer ist die Lust auf Neues. Eine Spurensuche in Neukölln, Zehlendorf und Marzahn (taz vom 4. Mai 2013)
lesen Sie weiter ...
Ikeas Fall
Zwangsarbeit im DDR-Jugendknast: Robert Strom hat es erlebt. Er musste Lampenfassungen für Ikea fertigen. Eine Begehung (Sonntaz vom 23. Februar 2013)
lesen Sie weiter ...
Neuberliner machen Geschichte
Nach 1937 und den beiden Feiern 1987 verzichtet Berlin bei der 775-Jahr-Feier 2012 ganz auf Inszenierung und feiert die Geschichte der Stadt als Leistung ihrer Zuwanderer. Chapeau (taz vom 27. August 2012)
lesen Sie weiter ...
Das war der Plan
Vor 150 Jahren wurde der Hobrechtplan verabschiedet. Der brachte zwar die Mietskasernen, aber auch die Berliner Mischung. Lange Zeit verpönt, wird das Werk des Ingenieurs James Hobrecht heute gewürdigt (taz vom 30. Juli 2012)
lesen Sie weiter ...
Neues vom Kartoffelkönig
Zu den Mythen um Friedrich II. gehört, dass er die Kartoffel nach Preußen gebracht habe. Stimmt nicht, ist aber im Friedrichjahr eine gute Gelegenheit, sich auf die Spur von König und Knolle zu begeben (taz vom 20. Juli 2012)
lesen Sie weiter ...
Der König und sein Kriegsgericht
300 Jahre Friedrich II.: Das Todesurteil gegen seinen Freund Katte war der Höhepunkt im Konflikt zwischen Kronprinz Friedrich und seinem Vater. Das Köpenicker Schloss stellt den Prozess als Gerichtsdrama aus (taz vom 4. Januar 2012)
lesen Sie weiter ...
"Er war ein großer Egoist"
Und wieder ein Preußenjahr. Anders als die Königin Luise taugt Friedrich II., dessen Geburtstag sich am 24. Januar 2012 zum 300. Mal jährt, aber nicht zur Popfigur. Ein Interview mit dem Friedrich-Biographen Jürgen Luh (taz vom 27. Dezember 2011)
lesen Sie weiter ...
Weltkultur, nah am Wasser gebaut
Das Oderbruch soll Unesco-Weltkulturerbe werden. Der überraschende Vorschlag einer Bürgerinitiative hat Charme, finden selbst Skeptiker. Von der Vergangenheit allein kann die einzigartige Kulturlandschaft aber nicht leben. Sie braucht auch Zukunft (taz vom 4. Februar 2011)
lesen Sie weiter ...
"Ich war ein richtiger Dorflümmel"
Jörg Schönbohm (CDU) hat als Soldat die NVA aufgelöst, als
Berliner Innensenator besetzte Häuser geräumt, als Brandenburger
Innenminister Rechtsextremen auf die Füße getreten. Jetzt geht
er in den Ruhestand (taz vom 12. Oktober 2009).
lesen Sie weiter ...
Neue Wildnis im Oderbruch
Im 18. Jahrhundert war die Trockenlegung des Oderbruchs der Beginn der Umgestaltung
der Landschaft in ganz Deutschland. Nun ist seine Zukunft unsicherer denn
je. Vier Szenarien bringen Bürger und Bürgermeister der Region
auf die Barrikaden (taz vom 19. Juni 2008).
lesen Sie weiter ...
Fontanes andere Wanderungen
Die Ausstellung "Mark und Metropole" beschreibt das Verhältnis
von Berlin und Brandenburg auch als wirtschaftliche und kulturelle Kolonisierung.
Und erzählt nebenbei vom Trost der Geschichte (taz vom 5. Mai 2008).
lesen Sie weiter ...
Architektur des Abbruchs
Baukultur ist das diesjährige Thema von Kulturland Brandenburg. Auf
einer Tagung ging es dabei um Schrumpfung und eine neue Art von Politik.
Und was die NPD mit zugezogenen Städtern gemein hat (taz vom 5. Oktober 2006).
lesen Sie weiter ...
Wie ich Neoliberaler wurde
Als am 9. November 1989 in Berlin die Mauer fiel, gingen zwei Welten zu
Ende, die sich gar nicht so unähnlich waren. Doch was folgte dann?
Für die einen war die Wende ein Verlust, für die anderen Neuanfang.
Seitdem finde ich sogar Touristen toll (taz vom 8. November 2004)
lesen Sie weiter ...
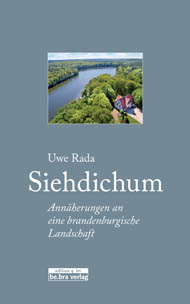 Siehdichum
SiehdichumNoch
viel Raum für Raumpioniere
Schrumpfung ist im Elbe-Elster-Land im Süden Brandenburgs nicht nur
Verlust, sondern auch Chance. Dazu bedarf es freilich der Vernetzung von
so genannten Raumpionieren - ideenreichen Kleinproduzenten - mit anderen
Akteuren vor Ort. So will es die Region aus eigener Kraft schaffen (taz vom 21. Juni 2005).
Luxus der
Leere
Forst in der Lausitz ist nicht nur eine schrumpfende, sondern auch eine
aussterbende Stadt. Doch was heißt das für die Zukunft? Die Stadt
stilllegen? Auf "Raumpioniere" warten? Nein, sagen die Forster
und erobern sich ihren Marktplatz selbst (taz vom 24. Juni 2004)
Frühstück
für immer
Nach Hoyerswerda kamen einst die Pioniere der DDR: Bergarbeiter, Architekten,
Stadtplaner. Sie bauten an der "sozialistischen Stadt". Heute
kommen wieder Pioniere nach "Hoywoy" und studieren, wie man eine
Stadt abbaut (taz vom 8. November 2003)
Landschaftsbilder
aus der Lausitz
Die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land sucht eine
Zukunft für das einstige Tagebaurevier zwischen Cottbus und Hoyerswerda
- mit einer Collage aus Natur, Tourismus und Industriedenkmälern (taz vom 6. Mai 2002).
Provinz
- Metropole - Region
Das war Balsam für die Berliner Seele. Im Sommer 2007 überraschte
das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mit einer Homestory über die deutsche
Hauptstadt. Ihr Titel: "Großstadt ohne Größenwahn".
Von einer selbstbewussten, demokratischen und heiteren Metropole war da
zu lesen, die so gar nichts gemein habe mit der Last ihrer Geschichte. (erschienen im Jahrbuch "Stoffwechsel. Brandenburg und Berlin in Bewegung" von Kulturland Brandenburg 2009).